





Was ist Glas?
Glas,
so wie wir es normalerweise kennen (als Fensterglas, Flaschenglas etc.)
ist eine erstarrte Flüssigkeit. Dies heisst, dass Glas keine Kristallstrukturen
hat und an und für sich auch bei Normaltemperatur flüssig ist.
Kann das sein? Ja. Es kann sogar gemessen werden. Bei ganz alten Gebäuden
mit entsprechend alten Gläsern lässt sich eine Verdickung des
Glases im unteren Teil feststellen, ähnlich der Plastilinmasse, die
langsam in sich zusammenfällt. Wer´s nicht glaubt solls selbst nachmessen, ich hab´s nicht gemacht ich glaube es.
Glas ist ein synthetisches Produkt. Das heisst es ist ein Material, das
durch geschickte Wahl der Rohstoffe daran gehindert wird wieder in seine
Einzelbestandteile zu zerfallen.
Was heisst das? In normalem Glas sind ca. 70 % Siliziumdioxid als geschmolzener
beziehungsweise gelöster Teil vorhanden. Das ist nichts anderes als
Quarz. Würden die anderen Glasinhaltsstoffe dieses Siliziumdioxid
nicht daran hindern sich wieder zu Quarz zu formieren, wäre das Glas
nicht stabil. Der hauptsächlichste Stoff für diesen Zweck ist
Kalk.
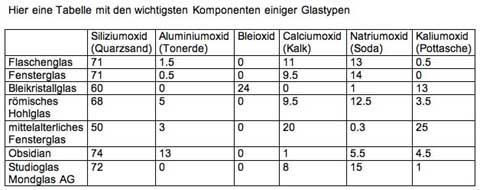
Was ist denn Obsidian?
Obsidian ist ein natürlich vorkommendes Glas. Es ist ein Vulkangestein und in manchen Gegenden in grossen Mengen zu finden. Es ist durch seinen Gehalt an Eisen und anderen Metallen tiefschwarz und kann wie Glas geschliffen und verarbeitet werden (Schmuck). Es ist brüchig, aber durch seinen hohen Aluminiumgehalt chemisch sehr stabil und überdauert die Jahrtausende schadlos.
Verarbeitung
Der
Glasmacher kann das flüssige Glas mit der Glasmacherpfeife
aus dem Glasschmelzofen holen und bearbeiten. Er taucht mit der Spitze der Pfeife
in die flüssige Oberfläche und dreht die Pfeife, ähnlich
wie man Honig aus dem Topf auf das Messer aufspult. Wird dieser Prozess
wiederholt, kann man grössere Glasmengen auf die Pfeifenspitze bringen
und auch grössere Objekte machen. Durch Blasen in die Glasmacherpfeife
werden Hohlformen gebildet. Um diesen Glasposten nicht nur aufzublasen,
sondern auch zu formen, hat der Glasbläser verschiedene Werkzeuge.
Er kann feuchtes Holz, nasses Papier, Metallformen und andere Materialien
verwenden. Will er zwei Glasstücke vereinigen müssen beide Teile
eine minimale Temperatur von ca. 700 Grad haben. Ist dies nicht der Fall,
verbindet sich das Glas nicht. Kühlt man das Glas zu schnell ab, bricht es ebenfalls,
da es innere Spannungen hat, die sehr viel Energie speichern und unkontrolliert
Risse bilden.
Die Arbeit mit flüssigem Glas erfordert eine gute Hand, ein gutes
Zeitgefühl (wichtig für die richtige Temperatureinschätzung)
und nicht zum Schluss eine hübsche Portion Kreativität.
Flüssiges Glas hat die gute Eigenschaft, dass es sich bei genügend
grosser Hitze zusammenziehen will. Man sagt diesem Phänomen Oberflächenspannung.
Hat man also Glas an der Glasmacherpfeife, hält diese Masse genügend
heiss und verhindert durch gleichmässiges Drehen, dass sie herunterfällt,
entsteht eine runde Kugel. Die Oberfläche wird vom Feuer poliert
und jede Vertiefung wird geglättet. Die Hochglanzoberfläche
unterscheidet auch die gute Handarbeit von der maschinellen Produktion.
Manchmal ist es aber auch gewollt, eine gerippelte, matte, milchige oder
sonst wie geartete Oberfläche zu bekommen. Den Ideen sind hier fast
keine Grenzen gesetzt. Man kann sogar Goldfolie, Silber oder Kupfer in
das Glas einbringen und quasi im Glas einbetten.
Wie kommen die Farben in das Glas?
Setzt
man dem Glasrohstoff Metalloxide wie Eisen-, Kupfer-, Mangan- oder Chrom-oxid
zu, dann bekommen die Gläser eine spezifische Farbe. So enthalten
die grünen Weinflaschen Eisen und Chromoxide. Die blauen Gläser
enthalten oft Kobaltoxid und die rubinroten sogar metallisch gelöstes
Gold. Schon die antiken Römer produzierten einen roten Glastyp mit
Gold als farbgebendem Inhaltsstoff.
Will der Glasmacher ein buntes Objekt machen, hat er die Möglichkeit,
buntes Glas direkt aus einem Hafen mit Buntglas zu nehmen (dazu braucht
es einen separaten Glashafen pro Farbton), oder nachträglich als
Farbglaspulver oder als Portion Farbglas auf die Glasmacherpfeife
aufzubringen. Den Farbkombinationen sind fast keine Grenzen gesetzt. Es
ist nur immer darauf zu achten, dass die Glastypen, die man kombinieren
will auch kompatibel sind. Flaschenglas ist zum Beispiel nicht kompatibel
mit unserem Studioglas oder Fensterglas. Da die Farbstoffe im Glas gelöst
sind, sind diese genauso wenig löslich wie das Glas selbst. Es ist
jedoch nicht zu empfehlen handgefertigtes Glas regelmässig in den
Geschirrspüler zu geben. Wussten sie, dass die Glasmacher schon lange vorgemacht haben was die NAGRA (Nationale Arbeitsgemeinschaft zur Lagerung Radioaktiver Abfallstoffe CH) uns allen jetzt verkaufen will? Es gibt ein uranhaltiges Glas! Dieses Glas schimmert in einem hellen grasgrünen Ton. Es ist radioaktiv und nicht wasserlöslich. Wenigsten die letzten Jahrhunderte hat es sich nicht aufgelöst und kann heute noch in den Museen mit wohlsortiertem Glaskunsthandwerk besichtigt werden. Fragen sie den Kurator bei ihrem nächsten Besuch in einem Museum nach Uranglas. Ich hoffe der fleissige Sammler läuft dann nicht rot wie die NAGRA Mitarbeiter an, wenn sie nach ihrer Arbeit gefragt werden. Apropos Rot: Rotes Glas wird auch mit Kupfer gemacht.
Welche Geräte braucht man im Studio?
Grob
gesagt braucht man einen Ofen in dem man flüssiges Glas erschmelzen
kann, einen Abkühlofen zum langsamen Abkühlen der hergestellten
Objekte und entsprechende Werk- und Sitzbänke.
An den Schmelzofen werden spezielle Anforderungen gestellt, da flüssiges
Glas ein ziemlich aggressives Medium ist und die Temperatur von über
1300 bis teilweise 1400 Grad auch nicht gerade ein Pappenstiel ist. Die
Arbeitsmittel sind jeweils auf den Glasbläser abgestimmt. Arbeitet
er nach der rheinischen Methode (gebräuchlich auch in Murano, Venedig)
sitzt er auf einer Werkbank mit langen ,,Armlehnen" auf der
er die Pfeife mit dem zu bearbeitenden Glas auflegt. Arbeitet er nach
der ,,böhmischen" Methode, will er möglichst dünnwandige
Hohlformen mit Holzformen herstellen und steht dazu meist auf einem Podest.
Die so hergestellten sehr dünnen und sehr wabbeligen Glasvorformen
bläst er in nasse Holzformen ein, die unterhalb seines Podestes stehen
und von einem Kameraden bedient werden.
Neben all diesem hat jeder Glasbläser und jedes Atelier seine eigenen
Werkzeuge, Hilfsmittel, Formen, Farben, Techniken etc.





Glasherstellung
braucht Energie
Es versteht
sich von selbst, dass die Erreichung von hohen Temperaturen auch immer
mit dem Einsatz von viel Energie einher geht. Die Hauptenergieform in
der Mondglas AG ist der Strom. Es bleibt eine Tatsache, dass zur Herstellung von Glas eine grosse Menge Energie verbraucht
wird. Leider können keine gesammelten Recycling Flaschen verwendet
werden, da das Flaschenglas eine ganz andere Zusammensetzung hat und meistens
auch eingefärbt ist. Der eigene Glasbruch hingegen kann wiederverwendet
werden.
Seit 2022 heizt die Sonne via PV-Anlage auf dem Hausdach den Ofen mit. Ca. 25 - 30 % des Jahreskonsums sollten so selbst hergestellt werden.
Im Jahr 2024 bezahlen wir hier in Hallau 50 % mehr für den gelieferten Strom im Vergleich zu 2022. Dafür machen unsere grossen Stromkonzerne Milliardengewinne. So ist es recht. Immer schön umverteilen.